EU-MERCOSUR-Abkommen: Ein unlösbares Trilemma zwischen Wettbewerbsregeln, normativen Ambitionen und der Diversifizierung der Lieferketten
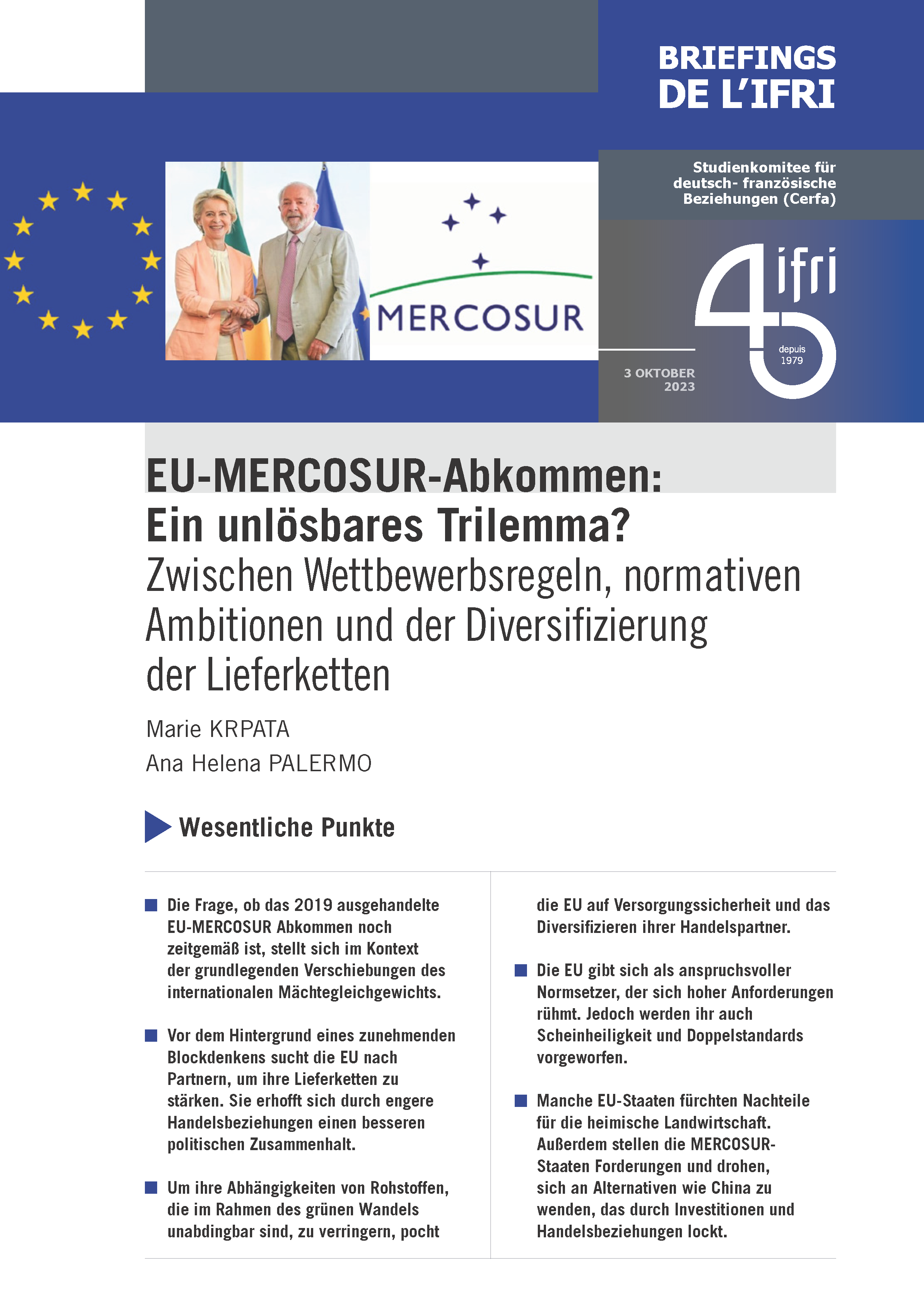
Man sah sich schon auf der Zielgeraden. Die Wahl von Luiz Inácio Lula da Silva zum brasilianischen Präsidenten, als Nachfolger auf den in der Kritik stehenden Rechtspopulisten, Jair Bolsonaro, sowie die spanische EU-Ratspräsidentschaft, gaben Anlass zur Hoffnung für den Abschluss des EU-Mercosur Abkommens. Doch Vorbehalte mehrerer EU-Mitgliedsstaaten und in manchen lateinamerikanischen Partnerstaaten dämpfen die Hoffnung auf eine baldige Einigung.

Lula will das Abkommen noch vor dem Ende des brasilianischen Mercosur-Vorsitzes, abschließen. Dieses Zeitfenster sollte man nützen, meinen Befürworter. Doch die EU besteht auf das Einhalten von Umweltstandards, als Bedingung für den Abschluss des Abkommens, was in den lateinamerikanischen Partnerstaaten auf wenig Begeisterung stößt. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Blockdenkens, das von der chinesisch-amerikanischen Systemrivalität und der, durch den Krieg in der Ukraine verschärften, Fragmentierung der internationalen Gesellschaft, geprägt ist, sucht die EU nach neuen Handelspartnern, mit denen sie grundsätzlich ein ähnliches Werteverständnis teilt. Grundsätzlich stellt sich aber die Frage, ob das 2019 ausgehandelte EU-Mercosur Handelsabkommen in der bestehenden Form noch zeitgemäß ist.
Versorgungssicherheit und Diversifizieren gehören zu den Schlagwörtern der EU-Strategie für wirtschaftliche Sicherheit, die Ursula von der Leyen im Juni 2023 vorstellte. Neben stärkeren Lieferketten und einer Verringerung der Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen, die im Rahmen des von der EU angestrebten grünen Wandels unabdingbar sind, erhofft sich die EU durch das EU-Mercosur Abkommen einen besseren politischen Zusammenhalt mit Lateinamerika. Doch in der EU herrscht Uneinigkeit über das EU-Mercosur Abkommen: Manche Mitgliedsstaaten fürchten Nachteile für die heimische Landwirtschaft. Doch auch die Mercosur-Staaten stellen zunehmend Forderungen und drohen sich an Alternativen, wie China zu wenden, das durch Investitionen und Handelsbeziehungen lockt.
Marie Krpata ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Studienkomitee für deutsch-französische Beziehungen (Cerfa) am Französischen Institut für internationale Beziehungen (Ifri).
Ana Helena Palermo ist Referentin des Präsidenten des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
Diese Publikation ist auch auf Französisch verfügbar: "UE-Mercosur : un trilemme insoluble entre règles de la concurrence, ambitions normatives et diversification des approvisionnements" (pdf).
>> >> Siehe zu diesem Thema auf Englisch verfügbar: Klemens Kober "Towards a New European Trade Strategy in Times of Geopolitical Upheaval: The German Perspective", Notes du Cerfa, Nr. 176, Ifri, Oktober 2023 (pdf).

Inhalte verfügbar in :
ISBN/ISSN
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Laden Sie die vollständige Analyse herunter
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer Arbeit. Wenn Sie mehr Informationen über unserer Arbeit zum Thema haben möchten, können Sie die Vollversion im PDF-Format herunterladen.
EU-MERCOSUR-Abkommen: Ein unlösbares Trilemma zwischen Wettbewerbsregeln, normativen Ambitionen und der Diversifizierung der Lieferketten
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?










