Die deutsch-indischen Beziehungen
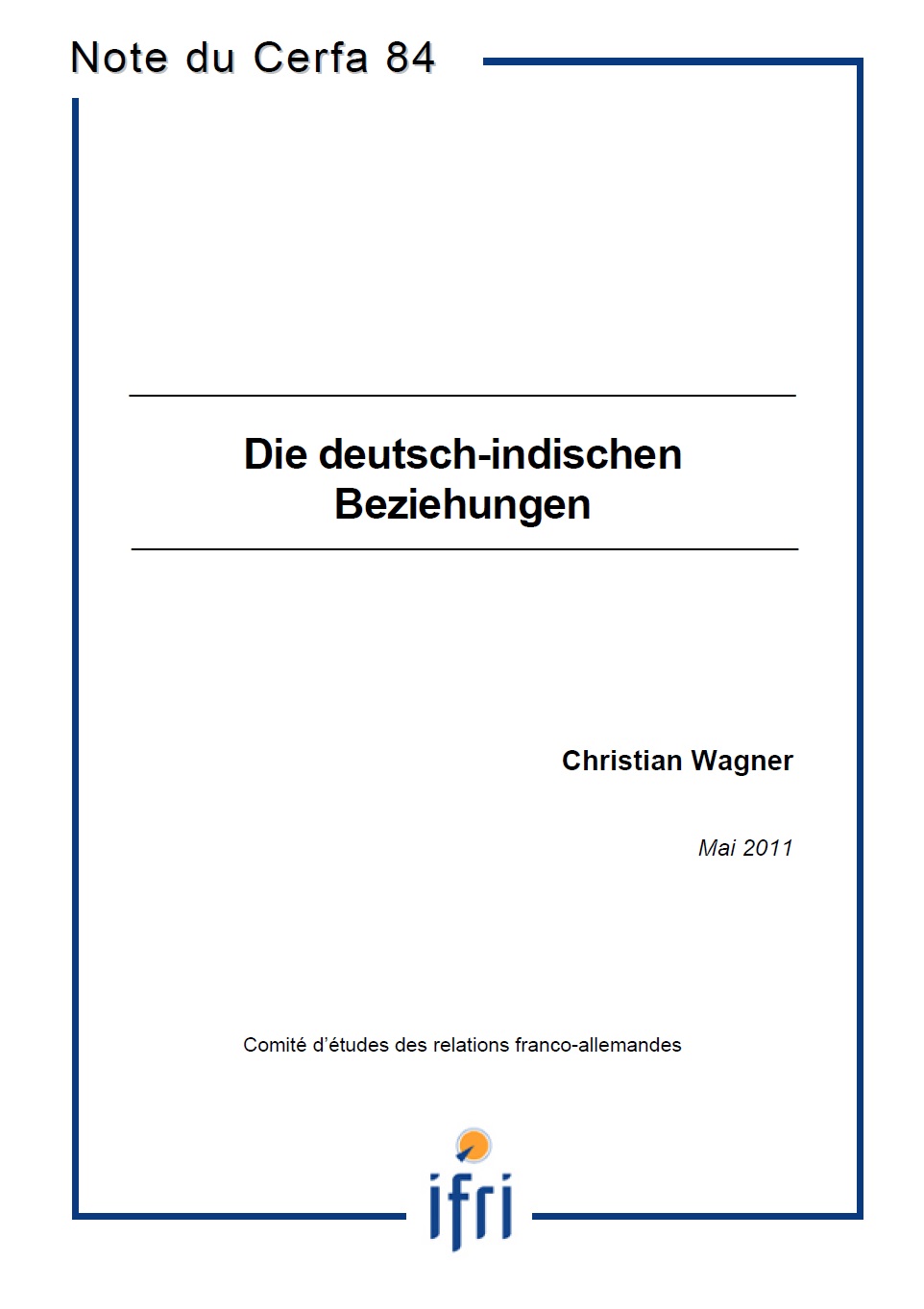
Die deutsch-indischen Beziehungen können als kontrastreich beschrieben werden. Dies erklärt sich an der Situation selbst, in der sich Indien befindet und die das Land zwischen Modernität und Wachstum auf der einen Seite und Armut und strukturellen Blockaden auf der anderen Seite zerreißt.Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten sind gut und haben noch deutliches Potential für weiteres Wachstum Probleme ergeben sich zum einen durch die Engpässe im Infrastruktur- und Energiebereich sowie durch die weiterhin vergleichsweise umständlichen Genehmigungsverfahren für ausländische Unternehmen in Indien. Ebenso ist der Austausch im Wissenschafts- und Technologiebereich dynamisch, leidet jedoch unter den Schwächen des indischen Ausbildungssystems.
Trotz des wirtschaftlichen Erfolgs und den positiven Wachstumsraten der letzten Jahre, bleibt Indien ein Entwicklungsland. Die deutsche Entwicklungshilfe hat sich während der letzten Jahre neu orientiert und setzt heute auf eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Umwelt, Energie und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung.Im Bereich Sicherheit bemüht sich Berlin mit New Delhi eine Partnerschaft auf höchstem Niveau einzugehen und stützt diese Politik durch den Export von Waffen und gemeinsame diplomatische Standpunkte. Trotzdem gibt es immer wieder Unterschiede und Differenzen zwischen dem effektiven Multilateralismus, auf den Deutschland setzt und der klassischen Großmachtrolle, die Indien anstrebt. Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Indien und darüber hinaus zwischen der EU und Indien können das Symbol für die zukünftigen politischen Werte und Ordnungsvorstellungen werden, die die deutsche und europäische Politik mit der größten Demokratie der Welt verbinden.
Christian Wagner ist Forschungsgruppenleiter des Programms Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Inhalte verfügbar in :
Regionen und Themen
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?







