Die Bundestagswahl 2009: Wahlkampf, Ergebnis und Regierungsbildung
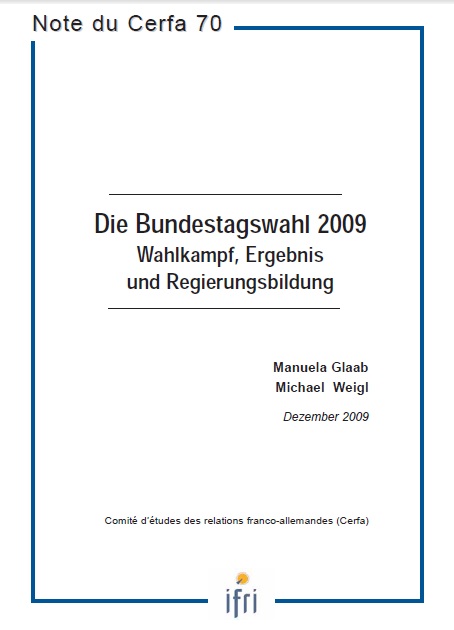
20 Jahre nach Öffnung des Eisernen Vorhangs ist die AKP derBundesrepublik nicht mehr von Nachkriegsrealitäten geprägt. Ihre leitenden Merkmale – Beständigkeit, Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit, auf Partnerschaft beruhende Zusammenarbeit – bleiben zwar nach wie vor bestehen. Gleichzeitig haben sich aber über die letzten zwei Jahrzehnte einige wichtige Veränderungen eingestellt. Diese Veränderungen machen die deutsche AKP vor allem politischer. Ein wichtiges Identitätsmoment deutscher AKP in der Nachkriegszeit und während des Kalten Krieges war ihre strukturelle und inhaltliche Ferne von der Politik. Dies erhöhte ihre Glaubwürdigkeit. Mit der stetigen Normalisierung deutscher Auslandsbeziehungen seit der Wiedervereinigung wird die AKP zunehmend mit Diplomatie und Wirtschaft verzahnt. Seit Ende der 90er Jahre nimmt die jeweilige Bundesregierung stärker Einfluss auf die Schwerpunktsetzung AKP. Allerdings hat sich während der letzten 20 Jahre aber auch gezeigt, dass die Bedeutung Auswärtiger Kulturpolitik und der Anspruch an sie deutlich gewachsen sind. Gleichzeitig haben die verschiedenen Mittlerorganisationen bewiesen, dass sie sich auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen können. Die Auswärtige Kulturpolitik wird ihre Aufgabe als dritte Dimension der deutschen Auslandsbeziehungen auch in den kommenden Jahren wahrnehmbar ausfüllen.
Seit August 2000 leitet Dr. Manuela Glaab die Forschungsgruppe Deutschland am Centrum für angewandte Politikforschung in München. Sie ist zugleich Akademische Oberrätin am Lehrstuhl "Politische Systeme und Europäische Einigung" des Geschwister-Scholl-Instituts für Politische Wissenschaft der LMU München.
Dr. Michael Weigl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Deutschland im Projekt "Grenzregionale Identitäten".

Inhalte verfügbar in :
Regionen und Themen
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?







