Europapolitische Debatten in Deutschland im Schatten der Verschuldungskrise
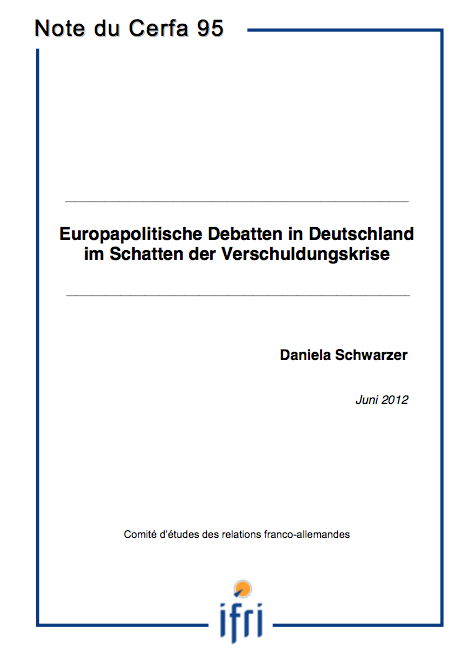
Die anhaltende Schuldenkrise bestimmt seit 2010 weitgehend die deutsche Europapolitik. Angesichts der wichtigen Rolle Deutschlands als Garantiegeber im Rettungsmechanismus und der hohen Verschuldung einer Vielzahl der Mitgliedstaaten der Eurozone, war die Frage nach dem richtigen Krisenmanagement im Zentrum der Debatten. Aufgrund der Überschreitung des ordo-liberalen Rahmens der Europäischen Währungsunion (EWU) und den daraus entstehenden Konsequenzen, sucht die Bundesrepublik nun vor allem einen Weg, die Reform der Governance-Strukturen voranzutreiben.
Eines der Hauptziele der deutschen Politik ist es die Währungsunion politisch wieder dem anzunähern, was man geglaubt hatte mit dem Vertrag von Maastricht zu gründen. Das Ziel ist, die Selbstverantwortung der Mitgliedstaaten für solide Haushaltspolitik und strukturelle Reformen zu stärken, die Regeln der wirtschafts- und haushaltspolitischen Koordinierung zu schärfen und ihre Anwendung zu verbessern. Grundsätzlich sollen gegenseitige Risikoübernahme minimiert und Interdependenzen und Haftungsgefahren reduziert werden.
Ein weiteres Thema in der europapolitischen Debatte Deutschlands ist die Rolle des Deutschen Bundestags im EU-Integrationsprozess, die durch das Lissabon-Urteil des deutsche Bundesverfassungsgerichts erheblich gestärkt wurde und die gesetzgebende Gewalt somit zu einem wichtigen Akteur der EU-Zukunftsdebatteheranwachsen ließ. Die sich zuspitzende Krise, die schnelles Handeln der Bundesregierung forderte, führte zu Spannungen zwischen der Regierung und dem Bundestag, die auch vor dem Gericht ausgetragen wurden.
In diesem Kontext mussten die deutschen politischen Parteien zu allen Themen, die mit der Krise verbunden waren, Stellung beziehen und haben vielzählige Vorschläge unterbreitet. Diese Positionen und Vorschläge werfen grundlegende Fragen zur Governance der Eurozone, der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und somit zur Zukunft der europäischen Integration auf.
Dr. Daniela Schwarzer leitet die Forschungsgruppe EU-Integration bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Sie ist wissenschaftliche Beraterin im Centre d'analyse stratégique des französischen Premierministers, unterrichtet an der Hertie School of Governance (Berlin) und nimmt regelmäßig Lehraufträge an verschiedenen Universitäten wahr.

Inhalte verfügbar in :
Regionen und Themen
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?







