Die deutsche Afrikapolitik: Welche Gemeinsamkeiten mit Frankreich?
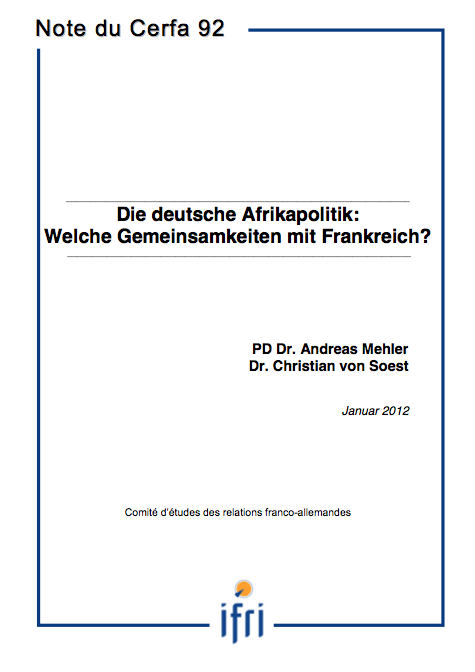
Während Abstimmungen im außenpolitischen Bereich für Deutschland und Frankreich eine Priorität darstellen, trifft dies nicht für die Afrikapolitik zu: In diesem Bereich haben sich die beiden Länder eher auseinanderentwickelt.
Die deutsche Afrikapolitik hat sich in den letzten fünf Jahren gewandelt, das neue Afrikakonzept der Bundesregierung betont wirtschaftliche Aspekte in der Zusammenarbeit mit Afrika und soll ein kohärenteres Auftreten der Bundesregierung im Nachbarkontinent fördern. Die deutsche Afrikapolitik steht aber immer noch in einer klar erkennbaren Tradition: großes Gewicht internationaler Foren und Bekenntnis zur Multilateralität, ein stattliches Portfolio und eine Vielzahl von Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit sowie vergleichsweise geringe politische Bedeutung des Nachbarkontinents in den auswärtigen Beziehungen.
Der – neben Entwicklungsfragen – schon seit der rot-grünen Regierung (1998) vorhandene Fokus auf Sicherheitsfragen hat sich keinesfalls abgeschwächt. Wie schon in der Vergangenheit gibt es einen parteiübergreifenden Konsens, dass der Einsatz militärischer Mittel nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt ist. In diesem Zusammenhang gibt es ebenfalls eine starke Kontinuität quer durch die Parteien und Ministerien: der Schwerpunkt deutscher Politik besteht darin, afrikanische Strukturen aufzubauen und zu befähigen, die vornehmliche Rolle in der Wahrung von Frieden und Sicherheit einzunehmen, und nicht selbst dieses Geschäft zu besorgen.
Die Irritationen im Verhältnis zu Frankreich, schon vor fünf Jahren sehr stark zu spüren, als einer der Autoren dieser Studie bereits eine größere Abhandlung zum Thema geschrieben hat, sind noch einmal gewachsen. Die Wahrnehmung Frankreichs als verhaftet in einer überholten Großmachtpolitik, stets bereit militärisch zu intervenieren („Gendarm Afrikas“) und nicht in der Lage, die Verstrickung seiner eigenen mit afrikanischen politischen Klassen zu beenden (die Republik der Geldkoffer) lassen die Attraktivität als Partner diesseits des Rheins gegenwärtig gegen null tendieren. Allerdings wird durchweg die militärische und diplomatische Handlungsfähigkeit Frankreichs gewürdigt.
Die Ereignisse zu Beginn des Jahres 2011, vor allem die Intervention in Libyen (die Meinungen zu Côte d’Ivoire variieren), haben verdeutlicht, dass sich sowohl die inhaltliche Politik als auch der Habitus sie durchzusetzen, zwischen Frankreich und Deutschland.
Andreas Mehler ist Direktor des Instituts für Afrikastudien am „German Institute of Global and Area Studies“ (GIGA) in Hamburg. Christian von Soest ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Afrikastudien am GIGA in Hamburg und Doktor der Politikwissenschaft der Universität Leipzig.

Inhalte verfügbar in :
Regionen und Themen
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Laden Sie die vollständige Analyse herunter
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer Arbeit. Wenn Sie mehr Informationen über unserer Arbeit zum Thema haben möchten, können Sie die Vollversion im PDF-Format herunterladen.
Die deutsche Afrikapolitik: Welche Gemeinsamkeiten mit Frankreich?
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?







