Die deutsch-französische Zivilgesellschaft: Gegenstand und Akteur der bilateralen Beziehungen. Bilanz und Perspektiven nach Unterzeichnung des Aachener Vertrags
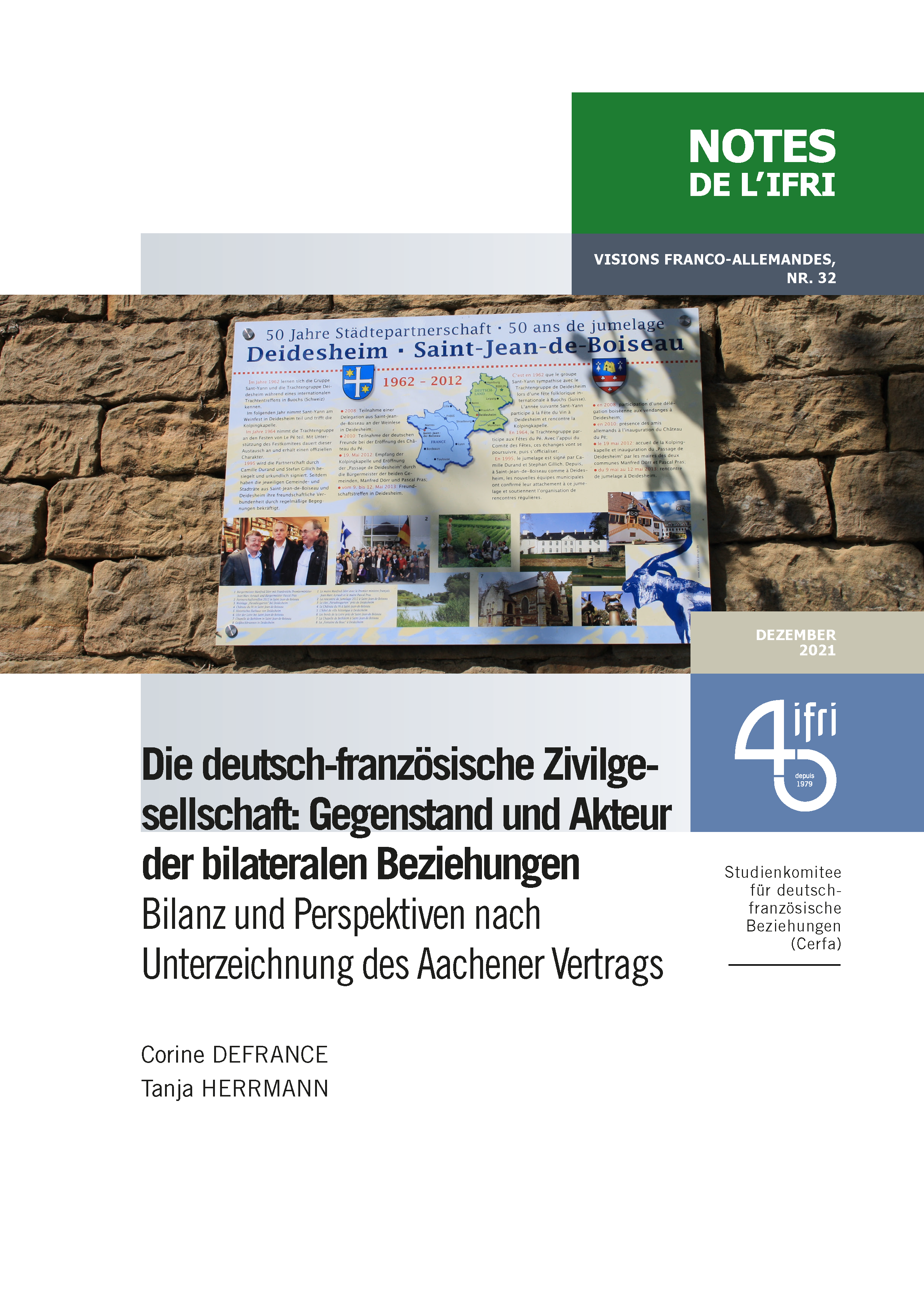
Der am 22. Januar 2019 in Aachen von Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete Vertrag unterstreicht die Rolle der Zivilgesellschaft in der bilateralen Zusammenarbeit und soll dazu beitragen, die „Gesellschaften [beider Länder] und ihre Bürgerinnen und Bürger enger zusammenzubringen“.

Dieser Diskurs spiegelt den Stellenwert wider, den die Regierungen, die sich lange Zeit fast ausschließlich auf ihre eigene Rolle im Prozess der deutsch-französischen Annäherung und Zusammenarbeit konzentrierten, nun gesellschaftlichen Akteuren einräumen. Seit Beginn des Jahrtausends würdigen Medien und öffentliche Akteure „Bürgerinitiativen“, die ein Garant für Demokratie und Engagement von unten sein sollen.
Ausgehend von einer Definition der Zivilgesellschaft, im Verhältnis zu wirtschaftlichen und staatlichen Akteuren, wird ihr historischer Beitrag bei der Gestaltung der deutsch-französischen Beziehungen kontextualisiert. Anschließend analysiert der Artikel aktuelle Fragestellungen und Auswirkungen der sogenannten Zivilgesellschaft auf die bilateralen und europäischen Kontakte. Am Beispiel der Städtepartnerschaften werden verschiedene Entwicklungsabschnitte im Laufe der Zeit dargestellt. Partnerschaften ermöglichen es, den Beitrag der Gesellschaften zur gemeinsamen Aufarbeitung der Vergangenheit und auch Antworten zu beleuchten, die sie auf die Herausforderungen der Gegenwart geben, wie etwa während der „Schließung“ der Grenzen zur Zeit der Corona-Pandemie. Heute gelten die Vereine oder gesellschaftlichen Foren als das Fundament der europäischen Vereinigung. Es ist ihnen auch gelungen, ihre Bedürfnisse zu spezifizieren, sie den Politikern besser zu vermitteln und somit sogar erfolgreich die Einrichtung des Bürgerfonds einzufordern. Sie koordinieren sich vermehrt, was sich unter anderem an den Initiativen der beiden großen deutsch-französischen Verbände FAFA und VDFG widerspiegelt, die sich als deutsch-französisches Bürgerbüro sehen, das über den bilateralen Rahmen hinausgehen und eine größere Rolle in Europa spielen soll. Es wird jedoch deutlich, dass die Arbeit der französischen und deutschen Verbände oft noch bilateral ist. Die Europäisierung der deutsch-französischen Initiativen der Zivilgesellschaft bleibt eine Herausforderung für die kommenden Jahre.
Prof. Dr. Corine Defrance ist Forschungsdirektorin am CNRS und stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums UMR SIRICE (Sorbonne Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe). Sie ist assoziierte Professorin an der Universität Paris 1-Panthéon-Sorbonne.
Dr. Tanja Herrmann ist promovierte Historikerin und hat im Oktober 2017 eine Dissertation in Cotutelle an der Universität Mainz und der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne über den zweiten Boom der deutsch-französischen Städtepartnerschaften (1985-1994) verteidigt.
Diese Publikation ist auch auf Französisch verfügbar: "Société civile franco-allemande : enjeu et acteur des relations bilatérales. Bilan et perspectives après la signature du traité d’Aix-la-Chapelle" (pdf)

Inhalte verfügbar in :
ISBN/ISSN
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Laden Sie die vollständige Analyse herunter
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer Arbeit. Wenn Sie mehr Informationen über unserer Arbeit zum Thema haben möchten, können Sie die Vollversion im PDF-Format herunterladen.
Die deutsch-französische Zivilgesellschaft: Gegenstand und Akteur der bilateralen Beziehungen. Bilanz und Perspektiven nach Unterzeichnung des Aachener Vertrags
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?







