Deutschlands Einsatz in Afghanistan: Die sicherheitspolitische Dimension
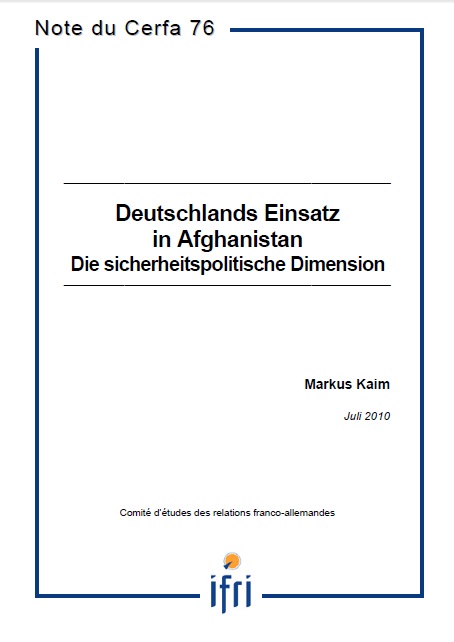
Bei der internationalen Afghanistan-Konferenz am 28. Januar 2010 sollten aus deutscher Sicht, die Ziele und Instrumente der internationalen Gemeinschaft, die für den Wiederaufbau des Landes eine Rolle spielen, auf den Prüfstand kommen. Dieses Bedürfnis resultierte im Falle Berlins aus der Einsicht, dass der Bundeswehreinsatz in Afghanistan nicht weiter gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung durchgesetzt werden kann.
Obgleich kein deutscher Politiker bislang ein offizielles Ende der deutschen ISAF-Mission öffentlich terminiert hat, so ist doch klar, dass Bundesregierung und Bundestag unausgesprochen auf den Zeitplan von Präsident Obama eingeschwenkt sind, vom Sommer 2011 an die nationalen ISAF-Kontingente aus Afghanistan sukzessive abzuziehen und die Verantwortung für die Sicherheit an die afghanischen Behörden zu übergeben.
Viel zu lange dominierte die Formulierung von vagen Zielen („islamistischen Terrorismus bekämpfen“, „Afghanistan demokratisieren“ u.a.m.) deren Realisierung letzlich unkontrollierbar war und ist. Erst in den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Londoner Afghanistan-Konferenz quantifizierbare „Benchmarks“ entwickelt, die es erlauben, in Abstimmung mit den Nato-Partnern in den verbleibenden drei bis vier Jahren den Verlauf und die Wirksamkeit der ISAF-Mission kontinuierlich zu kontrollieren.
Nur wenn es gelingt, den Prozess der Übergabe sicherheitspolitischer Verantwortung an die afghanischen Behörden an Termine zu binden, messbar zu machen und zu konditionalisieren, wird der ISAF-Einsatz und damit auch der deutsche Afghanistan-Einsatz in der noch verbleibenden Zeit ausreichend innenpolitische Legitimität genießen.
Markus Kaim ist Leiter der Forschungsgruppe „Sicherheitspolitik“ der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

Inhalte verfügbar in :
Regionen und Themen
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?







